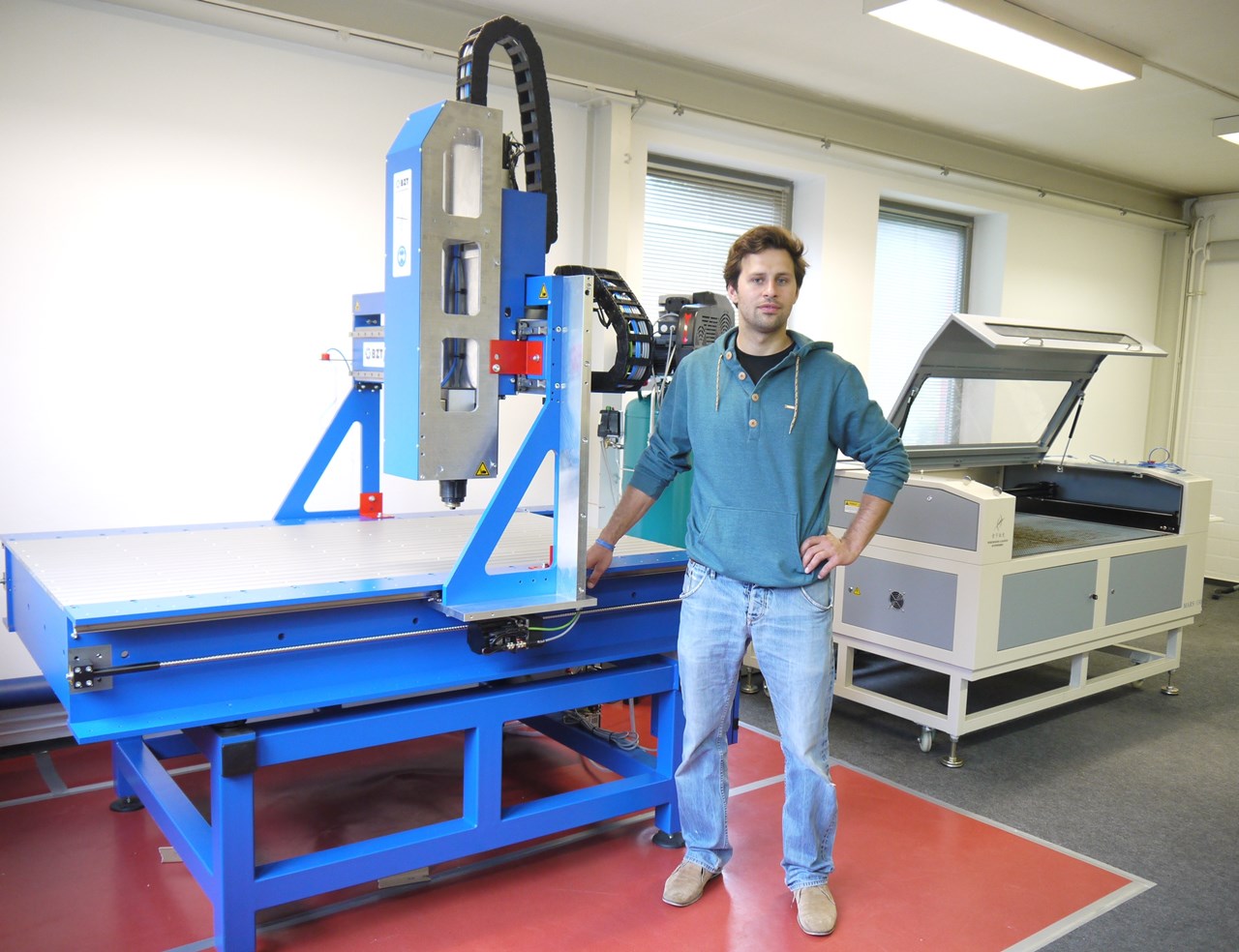Wer erinnert sich noch an die sprunghafte Entwicklung des Internets und die später so genannte „Dotcom-Spekulationsblase“ an den Aktienmärkten Ende der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts? Hartwig Aberger ist jemand, der mit dem Platzen der Blase nicht untergegangen ist, sondern seine Lübecker Internet-Agentur „vicon“ auf eine solide und zugleich innovative Art zum Erfolg geführt hat.
Vicon-Inhaber Hartwig Aberger und Mitarbeiterin Saskia Barre bei der Diskussion über ein Kundenprojekt
Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit sind dem heute 45-jährigen Ingenieur wichtig, damals wie heute, nach über 15 Jahren im sich schnell verändernden Internet-Geschäft. „Ich war 1998 recht früh dran, habe aber trotzdem nicht um Risikokapital gebuhlt, sondern einfach mit einem Studienfreund losgelegt, schlicht aus Begeisterung für die neuen Möglichkeiten des Webs, obwohl ich doch eigentlich Energietechnik studiert hatte“, erzählt Aberger rückblickend. „Und bis heute entwickelt sich unser Geschäft ohne großes Werbe-Tamtam durch ein sich ständig erweiterndes Multiplikatoren- und Empfehlungsnetzwerk.“ Wer zuverlässig arbeite, meint der Chef von heute fünf Mitarbeitern, könne über die Jahre stabiles Vertrauen aufbauen und mit den Kunden ein Partner-Netzwerk bilden. Nachhaltig sei das Geschäft genau dann, wenn es auf Lösungsorientierung und persönliche Authentizität setze. Und wenn man die technologische Entwicklung mitvollziehe und vorantreibe: „Innovation ist natürlich wichtig: Wir haben uns zum Beispiel in jüngster Zeit auf bestimmte Content-Management- und Online-Shop-Systeme konzentriert, die allen Anforderungen an moderne Internetlösungen gerecht werden. Dazu gehören auch flexibel skalierbare Websites und Shops für mobile Endgeräte wie Smartphones und Tablets durch sogenanntes ‚responsive‘ Webdesign.“ Hilfreich sei dabei die gute Zusammenarbeit mit befreundeten Firmen, die oft wie Aberger selbst aus der Lübecker Fachhochschule hervorgegangen sind.
„Am Anfang habe ich natürlich auch einfach Glück gehabt“, räumt der Agentur-Netzwerker ein. Bei einem Existenzgründungsseminar im Technikzentrum in der Seelandstraße habe er einen bis heute wichtigen Kunden kennengelernt, dessen Kontakte zu Geschäftspartnern in der ganzen Region dann alsbald zu weiteren Aufträgen geführt hätten. „Alle wollten damals ja ins Web, zumindest mit einer sogenannten Visitenkarte. Wir konnten mit Technik-Know-how und Kreativ-Qualität helfen – und schon sehr früh auch die ersten größeren Online-Shops und -Portale eröffnen, alles noch mit der Hand programmiert und von mir persönlich designt“, schmunzelt Aberger. Beim Design ist er bis heute geblieben, wenn die Kundenkontakte in ganz Deutschland und die Geschäftsführungsaufgaben ihm dazu Zeit lassen. Das Programmieren überlässt er lieber seinen Mitarbeitern. „Die jungen Leute können heute viel mehr als wir damals, haben hier an der Fachhochschule Medieninformatik oder ähnliche Schwerpunkte studiert und entwickeln sich mit den technischen Anforderungen der Systeme sehr engagiert ständig weiter“, lobt der Agentur-Chef, der im Laufe der Jahre nach eigener Aussage über 1500 Web-Projekte realisiert hat: „Anfangs vielleicht zwei im Monat, heute eher fünfzehn.“
Neben der pragmatisch-soliden Grundhaltung ist in diesen Jahren bei Vicon noch etwas konstant geblieben: Die Agentur-Adresse ist immer noch dieselbe wie 1998. „Warum hätten wir wechseln sollen, wenn wir hier im Technikzentrum Seelandstraße doch nach unseren Bedürfnissen räumlich wachsen konnten?“, so Aberger. Er könne sich an diesem Ort auf die Menschen und Geschäftspartner voll verlassen. Allerdings könne es sein, dass er in absehbarer Zeit einen weiteren Raum brauche, denn er suche gerade eine neue Mitarbeiterin. – Aber auch diese Aufgabe wird Hartwig Aberger sicher in gewohnter Manier lösen, im Netzwerk rund um das TZL und mit zielorientierter Gelassenheit, ganz solide eben.
Info: www.vicon.de